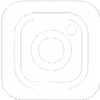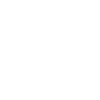Brusterhaltende Therapie: Oft sind Nachoperationen nötig
Häufig ist nach einer BET eine Nachresektion nötig. Warum das so ist und wie sich das Risiko reduzieren lässt.

Bei vielen Frauen mit Brustkrebs, die eine brusterhaltende Operation erhalten, wird später ein weiterer Eingriff notwendig, weil oft nicht alle Krebszellen erkannt wurden. Aber woran liegt das? Wie hoch ist das Risiko einer Nachresektion und wie lässt es sich reduzieren?
Ende April 2017 wurde bei Sandra Lotz ein Tumor in der linken Brust entfernt. Gut eine Woche später sitzt sie bei ihrer Ärztin, um die weiteren Behandlungsschritte zu besprechen. Zumindest dachte die mittlerweile 37-Jährige das.
Dann der Schock. Worauf Lotz nicht vorbereitet war: Bei der Gewebeuntersuchung im Labor, so erklärte es ihr die Ärztin, seien im Sicherheitssaum – das ist das mitherausoperierte, eigentlich gesunde Gewebe um den Tumor herum – leider doch noch Krebszellen gefunden worden. Es müsse nachoperiert werden. Ärzte nennen das eine Nachresektion.
Jede Fünfte wird nachoperiert
Was auch Sandra Lotz nicht wusste: Nachresektionen nach brusterhaltenden Therapien (BET) sind gar nicht so selten – und ihr Fall ist keineswegs die Ausnahme.
Im Jahr 2014 erschien im Fachblatt „JAMA Surgery“, für die Forscher der Universität Wisconsin in Madison die Daten des amerikanischen Krebsregisters von 316.000 Patientinnen aus den Jahren 2004 bis 2010 ausgewertet hatten. Demnach wurde jede fünfte Brustkrebspatientin, die eine brusterhaltende Therapie erhalten hatte, ein zweites Mal operiert. Bei unter 30-Jährigen waren es knapp 40 Prozent; bei Frauen, deren Tumor einen Durchmesser von fünf Zentimetern aufwies, nahezu jede zweite (48,2 Prozent). Eine kleinere Studie aus Großbritannien und Irland aus dem Jahr 2017 kommt zu einem ähnlichen Ergebnis.
Für Deutschland gibt es noch keine Zahlen. „In bundesweiten Tumorregistern und im Rahmen der Zertifizierung von Brustzentren werden die Nachresektionsraten erfasst; langjährige Auswertungen liegen dazu in Deutschland aber noch nicht vor“, berichtet Nina Ditsch, Gynäkologin und Oberärztin der Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe München. Sie geht aber von vergleichbaren Fallzahlen aus.
Möglichst nah an die Tumorgrenze
Doch woran liegt das? Passen manche Ärzte bei der ersten Operation einfach zu wenig auf?
„So einfach ist das nicht“, erklärt Ditsch, die selbst seit über 15 Jahren am OP-Tisch steht und dort Frauen mit Brustkrebs operiert. Lässt sich der Tumor wie ein Knoten ertasten, können Ärzte in der Regel gut bestimmen, wie viel umliegendes Gewebe zur Absicherung mitentnommen werden muss. „Viele Tumore haben diese ‚klaren’ Ränder jedoch nicht“, so Ditsch. Schwer zu behandeln sind daher auch Krebsvorstufen wie das sogenannte duktale Carcinoma in situ (DCIS), die häufig den Haupttumor umgeben. Ihre genauen Grenzen lassen sich mit „unseren bildgebenden Verfahren teilweise nur schwer abbilden“, erklärt die Gynäkologin. Mitunter kaum zu erkennen sind auch die mikroskopisch feinen Ausläufer, die einige Tumore haben.
Egal, wie gut oder erfahren der Operateur oder die Operateurin ist: Das Tumorgewebe kann er zum Großteil weder sehen noch ertasten. Deshalb wird die Tumormitte ebenso wie seine Anfänge und Enden vor dem Eingriff mithilfe bildgebender Verfahren wie Mammographie, Ultraschall oder der Magnetresonanztomographie (MRT) lokalisiert und mit einem feinen Draht oder einem Titanclip markiert. Die feinen Ausläufer lassen sich mit diesen „Ankern“ allerdings nicht erkennen. Wie viel Gewebe mitentfernt wird, ist immer auch eine Abwägung zwischen Absicherung und Brusterhalt.
Für Simone Wesselmann von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG), sind Nachresektionen daher auch kein Zeichen dafür, dass bei der Operation etwas schiefgegangen ist. Entscheidend sei, dass etwaig übersehene Krebszellen „am Ende erkannt und entfernt werden.“
Am Ende entscheidet die Patientin
Tatsächlich geht es bei einer brusterhaltenden Therapie neben der Entfernung des Tumors auch um ein gutes kosmetische Ergebnis. Deshalb versuchen Ärzte zwangsläufig, möglichst nah an den Tumorgrenzen zu operieren und nicht zu viel gesundes Gewebe zu entfernen. „Grundsätzlich ist das auch richtig und nachvollziehbar“, meint Oberärztin Ditsch, „aber natürlich steigt so das Risiko einer Nachresektion.“
Das bei der Operation entnommene Gewebe sollte nach dem Eingriff daher immer pathologisch untersucht werden – nur so lässt sich sicherstellen, dass an den Resektionsrändern keine Krebszellen übersehen wurden.
Sollte der Sicherheitssaum großzügig bemessen sein oder so schmal wie möglich? Ist eine Mastektomie nötig oder „reicht“ eine brusterhaltende Operation? „Am Ende wird das Vorgehen individuell zusammen mit der Patientin besprochen und festgelegt“, sagt Nina Ditsch. So sieht es auch Simone Wesselmann von der DKG. Deshalb fordert sie Ärzte dazu auf, ihre Patientinnen wirklich umfassend über die Möglichkeiten und Komplikationen jeder Operationsform aufzuklären.
Neue Methoden wie Abklatschzytologie oder Margin Probe, ist Oberärztin Ditsch überzeugt, werden die Nachresektionsraten zukünftig noch weiter minimieren. Mit dem Margin Probe-System etwa können die Schnittränder des entnommenen Brustgewebes innerhalb weniger Minuten noch im OP bewertet werden. Damit erkennen Medizinern Brustkrebsgewebe in Echtzeit und können es direkt während der Operation komplett entfernen.
Sandra Lotz fühlt sich im Nachhinein nicht gut informiert. Letztlich sieht sie die zweite Operation jedoch positiv: „Ich bin einfach froh, dass jetzt alle Krebszellen draußen sind und die Bestrahlung beginnen kann.“
Hinweis zu medizinischen Inhalten
Art, Verlauf und Therapie einer Brustkrebserkrankung sind von Frau zu Frau unterschiedlich. Wir bemühen uns, Sie umfassend, sachlich korrekt und verständlich über medizinische Hintergründe zu informieren. Eine Beratung oder Behandlung durch einen Arzt können diese Informationen jedoch nicht ersetzen. Die Informationen können Sie jedoch bei der Vor- oder Nachbereitung eines Arztbesuches unterstützen.
5. September 2018
Bild: GARO/picture alliance/Phanie