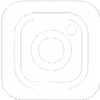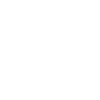Ein Tag im Leben einer Breast Care Nurse
Breast Care Nurses sind auf Brustkrebs spezialisierte Pflegefachkräfte. Wir haben eine von ihnen begleitet.

Breast Care Nurses sind spezialisierte Krankenschwestern und Pflegeexpertinnen für Frauen mit Brusterkrankungen. Aber was genau ist eigentlich ihre Aufgabe in einer Klinik? Um besser zu verstehen, was es mit diesem Tätigkeitsbild auf sich hat, haben wir eine Brustschwester einen Tag lang bei ihrer Arbeit begleitet.
Mittwoch, 13. Dezember 2017, 7.20 Uhr, Universitätsmedizin Greifswald
Breast Care Nurse Ute Stutz stellt ihr Auto auf dem Parkplatz der Universitätsmedizin Greifswald ab. Auf der Rückbank zwei Kindersitze, dazwischen Plastiktüten vom letzten Einkauf. Da Ute Stutz heute ohne ihre Enkel unterwegs ist, laufen im Radio mal keine Schlager, sondern Nachrichten. Bevor sie aussteigt, lehnt sie sich über das Lenkrad und schaut nach oben. Es hat angefangen zu regnen. Stutz zieht den Reißverschluss ihres roten Anoraks bis unters Kinn hoch und steigt aus.
Auf dem Weg zum Eingang des Krankenhauses geht es direkt durch eine Reihe von Pfützen. Dass die Stiefel jetzt nass sind, scheint für Stutz keine Rolle zu spielen. Die Zeit läuft.
Hintergrund zur Reportage
Für die Geschichte haben wir die Breast Care Nurse Ute Stutz einen Tag lang bei ihrer Arbeit begleitet. Da wir nicht alle ihre Tätigkeiten in der Reportage beschreiben konnten, finden Sie in dem Beitrag eine Auswahl der wichtigsten Stationen. Die Namen der Patientinnen sind von der Redaktion geändert.
Die verschiedenen Stationen des Tages haben wir auch in Bildern festgehalten. Sie finden Sie in unserem Facebook-Fotoalbum „Ein Tag im Leben einer Breast Care Nurse“.
Ute Stutz ist 56 Jahre alt. Seit über 30 Jahren arbeitet sie in der Gynäkologie des Uniklinikums. Zunächst als Schwester, dann als Stationsleitung. In der Position fühlte Stutz sich jedoch nicht wohl. Das Erstellen von Schichtplänen, die Koordination der Einsätze von Pflegern und Krankenschwestern entfernte sie von ihren Patienten. Vor einigen Jahren schulte sie dann zur Pflegeberaterin um und absolvierte an der Charité in Berlin eine Weiterbildung zur Breast Care Nurse. Seitdem findet man Ute Stutz nicht mehr nur in der Frauenklinik im dritten Stock, sondern auch im Patienteninformationszentrum (PIZ) im Erdgeschoss, gleich gegenüber der Cafeteria.
Ihre Tätigkeitsbezeichnung verdanken Ute Stutz und ihre Berufsgenossinnen den Briten; das Berufsbild „Breast Care Nurse“ hat sich mittlerweile allerdings auch in Deutschland etabliert. Dabei unterscheiden sich ihre Aufgabengebiete von Klinik zu Klinik und von Station zu Station teilweise deutlich. Ein festes Curriculum gibt es (noch) nicht. In der Ubbo-Emmius-Klinik in Aurich sind Breast Care Nurses beispielsweise von Anfang an Teil des Behandlungsteams. Sie besuchen gemeinsam mit dem behandelnden Arzt die Tumorkonferenz, besprechen mit der Patientin die Therapieempfehlungen, begleiten die Frauen durch Chemotherapie und Bestrahlung.
Anders in Greifswald, wo Ute Stutz arbeitet. Hier wird Frauen, wenn sie ins Brustzentrum kommen, ein Fragebogen zur Bedarfsanalyse ausgehändigt. Wollen sie, dass Breast Care Nurse Stutz oder andere Mitarbeiter des PIZs sie betreuen, müssen sie dem Angebot ausdrücklich zustimmen. Tun sie das nicht, besucht Stutz sie erst zu Beginn der Chemotherapie, um sie über die Nebenwirkungen aufzuklären.
Doch egal, ob in Aurich, Greifswald oder München – jede Breast Care Nurse versucht, die von ihr betreuten Patientinnen auf ihrem Weg zu unterstützen und zugleich Ärzte und Krankenpfleger für deren Bedürfnisse zu sensibilisieren. Gerade am Anfang der Diagnose sind viele Frauen von den zahlreichen Informationen überfordert. Ärzte bekommen das oft nicht mit. Ute Stutz und ihre Kolleginnen achten daher darauf, dass die Patientinnen wirklich verstehen, was in der Behandlung passiert – etwa, indem sie einfach nachfragen und sich erkundigen, was der Arzt bei der letzten Visite berichtet hat.

9.00 Uhr Pflegevisite in der Gynäkologie
Draußen scheint jetzt die Sonne. Auch die Station wirkt hell und freundlich. Ute Stutz trägt eine grau-weiß karierte Bluse, darunter ein türkisfarbenes Hemd. Zusammen mit drei Kolleginnen – die eine pflegerische Fachkraft mit einer Auszubildenden, die andere Sozialarbeiterin – bespricht sie im Stationszimmer den Fall einer neuen Patientin. Kommen Ärzte oder Pflegekräfte vorbei, wird herzlich gegrüßt. Man kennt sich.
„Jana H.*, Mammakarzinom im fortgeschrittenen Stadium mit Metastasen im rechten Lymphknoten“, stellt die pflegerische Fachkraft die Patientin kurz vor. Am Sonntag hatte die Frau sich wegen einer akuten Blutung der linken Brust selbst eingewiesen. „Die Patientin lebt allein, hat keine Kinder und kümmert sich um ihre pflegebedürftige Mutter“, fügt sie hinzu.
Ute Stutz und die Sozialarbeiterin nicken betroffen. Keine weiteren Fragen. Gemeinsam gehen sie zur Zimmertür Nummer 14 und klopfen an.
Die Patientin sitzt auf ihrem Bett und schaut aus dem Fenster. „Mein Verband ist verrutscht“, ruft sie in Richtung der drei Hereinkommenden. Dass Krankenhausnachthemd ist hinten offen, was sie aber nicht zu stören scheint. „Um den Verband kümmern wir uns gleich“, sagt die Pflegefachkraft: „Geht es Ihnen ansonsten gut?“ Jana H. nickt und lächelt. Dann fragt die Sozialarbeiterin, ob sie schon weiß, wer sich während ihres Krankenhausaufenthalts um ihre Mutter kümmern wird. Der 57-Jährigen rollen nun Tränen über die Wangen.
Ute Stutz übernimmt. „Das wird schon“, sagt sie mit herzlicher Autorität. „Jetzt ist es erst mal gut, dass Sie hier sind. Wir kümmern uns um Sie.“ Die Patientin schaut auf und lächelt Stutz erleichtert an. Die Breast Care Nurse verabschiedet sich und geht zur ihren nächsten Patientinnen.
Dass Frauen mit derart auffälligen Symptomen erst so spät zum Arzt gehen, ist insgesamt eher die Ausnahme; in einem ländlich geprägten Gebiet wie Mecklenburg-Vorpommern kommt das jedoch immer wieder vor. Nicht nur wegen der weiten Wege und der vielen Arbeit mit Haus und Familie. Viele Frauen redeten sich auch ein, so jedenfalls erleben es Stutz und ihre Kolleginnen, dass die Brust schon von alleine heilen werde.

11.00 Uhr Nachbesprechung mit einer Patientin
Ute Stutz klopft an die Tür von Zimmer Nummer 13, tritt ein und wird direkt mit einem Lachen begrüßt – dem von Anna G. Diese sitzt auf ihrem Bett und winkt vorsichtig mit ihrem rechten Arm. „Sehen Sie! Keine Schonhaltung“, sagt sie strahlend.
Stutz ist offensichtlich zufrieden und setzt sich ans Bett. Ihre Patientin hat den ersten Teil der Behandlung bereits hinter sich. Chemotherapie und Mastektomie sind überstanden, das Implantat wurde Anna G. schon während der Operation eingesetzt. Unter ihrem Arm klemmt ein selbstgenähtes Herzkissen, das nach dem Eingriff hilft, Wundschmerzen zu lindern. Auf dem kleinen Tisch neben ihr steht eine Vase mit lachsfarbenen Rosen, daneben liegt eine angebrochene Tafel Schokolade – der Appetit ist offenbar auch zurück.
„Wie geht es Ihnen mit dem Implantat?“, fragt Stutz.
„Erst dachte ich, dass es rutscht, wenn ich mich bewege. Aber ich glaube, das ist Einbildung“, antwortet Anna G. und lacht.
„Ist das Taubheitsgefühl in den Füßen und Händen weg, von dem Sie mir letztens erzählt haben?“, fragt Stutz weiter – die Patientenakte liegt geschlossen auf ihren Knien. Als Anna G. den Kopf schüttelt, schreibt die Breast Care Nurse den Namen einer Salbe auf einen Zettel und gibt ihn ihr.
„Die stimuliert die Nerven“, sagt sie, „das sollte helfen.“
Bevor Ute Stutz sich von ihrer Patientin verabschiedet, sagt sie noch: „Sie wissen, dass Sie uns jederzeit anrufen können – auch wenn Sie wieder zu Hause sind?!“
Dann geht es auch schon weiter zur nächsten Patientin. Dann geht es Richtung Cafeteria zur Mittagspause.
Vor allem Frauen mit Brustkrebs brauchen feste Ansprechpartner – während der Therapie und auch danach. Zu Beginn der Behandlung funktionieren viele von ihnen einfach, ziehen durch, was durchzuziehen ist. Mit der Entfernung des Tumors, dem ersten Gefühl von Entspannung fallen einige jedoch in ein emotionales Loch. Und dann ist da noch die körperliche Veränderung.
Ute Stutz will die Frauen auf diese Phase vorbereiten, ihnen im Vorfeld etwas an die Hand geben und ihnen Informationen vermitteln, wie sie die Therapie aktiv und selbstständig beeinflussen können. So hilft sie den Patientinnen dabei, eine geeignete Sportgruppe zu finden („Gemeinschaft tut immer gut!“), sie klärt sie darüber auf, worauf sie bei der Chemotherapie achten sollten („Achte darauf, viele eiweißreiche Lebensmittel zu essen“) oder sie stellt sich zusammen mit ihnen vor den Spiegel („Siehst du, die Narben sind gar nicht so schlimm“).
„Ich weiß, wie gut es tut, aktiv zu sein und das Leben selbst in die Hand zu nehmen“, sagt Stutz. Sie ist in der DDR aufgewachsen und engagierte sich schon als junges Mädchen bei den „Jungen Sanitätern“, einer außerschulischen Arbeitsgemeinschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) der DDR. Um den Notfall zu üben, veranstalteten die Jungen Pioniere regelmäßig Wettkämpfe, bei denen Ute Stutz zusammen mit ihrem Team Patienten bergen musste. Auch deshalb hat sie neben ihrer pflegerischen Tätigkeit noch eine Lizenz zur Reha-Übungsleiterin erworben und sich lange Zeit in der Arbeitsgruppe „Breast Care Nurse“ (BCN) der Konferenz Onkologischer Kranken- und Kinderkrankenpflege (KOK) der Deutschen Krebsgesellschaft engagiert. „Nur wer etwas tut, kann etwas bewegen“, sagt sie.

14.00 Uhr Seminar „Fatigue“
„In der Fachsprache wird die häufig auftretende körperliche und emotionale Erschöpfung, von der viele Patientinnen nach der Chemotherapie berichten, Fatigue genannt“, erklärt Ute Stutz, „manche nennen es auch das Überforderungssyndrom“. Auf einer Wand hinter der Breast Care Nurse sieht man eine Powerpoint-Präsentation, neben ihr steht Kathrin Lubig, eine Frau mit kurzen schwarzen Haaren, die zusammen mit Stutz das Seminar leitet. Vor den beiden sitzen gut 15 Medizinstudierende. Zu dem Seminar haben sich alle freiwillig angemeldet. Draußen zieht sich der Himmel wieder zu.
„Nach der Chemotherapie bin ich auch in dieses Loch gefallen“, berichtet Kathrin Lubig, „Mir hat vor allem Bewegung geholfen.“ Und die Fähigkeit, den Druck auf sich selbst zu lockern. „Mir zu erlauben, auch mal den ganzen Tag im Bett zu bleiben und zu lesen, musste ich erst lernen.“
„Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf?“, erkundigt sich ein Student. „33“, sagt Lubig. Dann erzählt sie, dass ein Jahr nach dem Ende der Brustkrebs-Therapie ihre Beine und ihr Becken anfingen zu schmerzen. Diagnose Knochenmetastasen. „Die sind nicht heilbar“, erklärt Lubig, „aber die Medikamente, die ich bekomme, schlagen gut an.“ Im Raum wird es hörbar leise. „Ich kenne Menschen, die sind mit ihren Metastasen 65 Jahre alt geworden“, sagt sie schließlich, auch um die Studenten nicht zu sehr zu belasten.
Das Seminar zum Thema „Fatigue“ geben Stutz und Lubig nun schon zum dritten Mal. Anfangs enthielt der Part von Ute Stutz 15 Folien. Mittlerweile hat sie ihren Vortrag um gut die Hälfte gekürzt. „Für Studierende und angehende Ärzte“, sagt sie, „ist es viel interessanter, Kathrins Geschichte zu hören.“
Mit ihrem Vortrag wollen Stutz und Lubig Studenten und Ärzte für die Situation ihrer Patientinnen sensibilisieren. Vom chronischen Erschöpfungssyndrom wissen die meisten bestenfalls vom Hörensagen. Selbst gestandene Onkologen kennen das Phänomen Fatigue, das häufig bei Krebspatientinnen als Folge von Chemo- oder Strahlentherapie auftritt, mitunter nicht. Vermutlich, so Stutz, weil die Betroffenen „selten Ansprüche stellen und zu allem Ja sagen“. Umso wichtiger sei es deshalb, dass Ärzte die Symptome erkennen und richtig behandeln. Beispielsweise mit körperlicher Bewegung.
15.15 Uhr Auf dem Gang
Das Seminar ist vorbei und Ute Stutz auf dem Weg ins Patienteninformationszentrum. Im Gang trifft sie Judith. Die beiden umarmen sich kurz, dann muss Stutz auch schon weiter.
Judith ist gelernte Kinderkrankenschwester und hat sich vor einigen Jahren zur Fachkraft für onkologische Pflege weitergebildet. Im Gegensatz zu einer Breast Care Nurse ist sie damit nicht auf eine bestimmte Krebserkrankung spezialisiert, sondern allgemein auf die Pflege krebskranker Menschen.
„Judith ist ein sehr liebevoller und empathischer Mensch“, sagt Ute Stutz. Von ihr hat sie gelernt, mit Patienten umzugehen, bei denen die Therapie nicht anschlägt, sie behutsam auf das Ende vorzubereiten – darauf, dass sie vermutlich bald sterben werden.
Das Patienteninformationszentrum der Universitätsmedizin Greifswald
Bleiben nach einem Gespräch mit dem behandelnden Arzt oder Therapeuten noch Fragen offen, können sich Patienten der Universitätsmedizin Greifswald an das Patienteninformationszentrum (PIZ) wenden. Das PIZ ist eine unabhängige Beratungsstelle, die vom Uniklinikum gefördert und finanziert wird. Die Mitarbeiter des Informationszentrums helfen nicht nur, Diagnosen und Behandlungspläne besser zu verstehen, sondern beraten auch bei der Beantragung von Hilfsmitteln, vermitteln Kontakte zu Selbsthilfegruppen und führen Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen im Zusammenhang mit Gesundheit, Krankheit, Vorsorge, Nachsorge und Pflege durch.
Denn wenn der Arzt dem Patienten die Nachricht überbringt, können viele die Diagnose nicht annehmen und sind erst einmal geschockt. In solchen Momenten ist es wichtig, einfühlsam auf den Patienten zuzugehen, mit ihm mitzufühlen und dennoch den nötigen Abstand zu finden. „Wir dürfen mit unseren Patienten weinen“, sagt Stutz, „aber wir dürfen nicht zusammenbrechen.“
Einfach ist das nicht. Ein Fall, der Pflegefachkräfte und Ärzte der Universitätsmedizin Greifswald gleichermaßen bewegte, war der von zwei jungen Frauen. Zwillinge, Mitte 30 und eine der beiden war an Krebs erkrankt – die Metastasen befanden sich nicht nur in der Leber, sondern auch im Gehirn. Der Krebs war einfach überall. Als sie starb, verbarrikadierte die andere sich im Krankenzimmer. Kein Arzt sollte den Körper ihrer Schwester anfassen. „Die junge Frau wollte den Tod ihrer Schwester einfach nicht wahrhaben“, erzählt Ute Stutz sichtlich bewegt. Wie es der Frau heute geht, weiß sie nicht, doch der Fall beschäftigt sie bis heute. Für Trauer, das musste die Breast Care Nurse mit den Jahren lernen, gibt es kein Patentrezept.

15.30 Uhr Patienteninformationszentrum
Draußen wird es langsam dunkel. Ute Stutz sortiert die Patientenakten des Tages und packt ihre Sachen zusammen.
„Hast du eigentlich genug getrunken heute?“, fragt ihre Kollegin. Ohne die Antwort abzuwarten, reicht sie Ute Stutz ein Glas Wasser. Diese setzt sich hin, atmet tief durch und trinkt. Keine Frage, der Tag hat Spuren hinterlassen. „Ich bin's wohl nicht gewohnt, den ganzen Tag mit der Kamera begleitet zu werden“, sagt die 56-Jährige und lacht.
Als sie kurz nach vier am Ausgang des Krankenhauses steht, regnet es wieder. Ute Stutz zieht den Reißverschluss ihres roten Anoraks hoch und macht sich auf den Weg zu ihrem Auto. Diesmal allerdings versucht sie, den Pfützen auszuweichen.
*Die Namen der Patientinnen sind von der Redaktion geändert.

5. Juni 2018
Fotos: Tobias Gratz
Infografik: Sandy Braun